Kein Weg führt am Gendern vorbei und dabei so schnurstracks in die Sackgasse | Geschlechter-gerechter zu formulieren ist mittlerweile nicht nur an den Unis üblich: Die Augsburger Allgemeine hat sich vor Kurzem dazu entschieden, sanft zu gendern. Mir spült es in den letzten Tagen immer häufiger eine YouTube-Werbung von Nivea vor die Nase, wo von „Wissenschaftlerinnen“ gesprochen wird, und ich könnte schwören, dass in dem Bild auch ein paar Männer sind – würde das Bild nicht so schnell an einem vorbeisausen.
Was an mir aber nicht vorbeizischt, ist die Diskussion an sich; denn die mausert sich schnell zu einem emotionalen Vulkanausbruch: Sprache betrifft nunmal uns alle und auch die Tatsache, dass man ein Geschlecht hat – oder eben keins. Jeder will sich wertgeschätzt und angesprochen fühlen. Indes trägt das generische Maskulinum einen fragwürdigen Ruf …
Und dabei könnte genau es die Lösung sein!
Ich selbst bin mit den bisherigen Vorschlägen zumindest gar nicht zufrieden. Auch wenn ich es durchaus versucht habe – und offensichtlich kein weißer, alter Mann bin. Maximal eine weiße, mittelalte Frau. Aber immerhin nicht aus dem Mittelalter!
Update (März 2022): Aktuell tut sich immer mehr in diesem Gebiet. Immer mehr junge, aufgeschlossene, offenkundig nicht antifeministische Leute äußern sich gegen das Gendern. Alicia Joe fasst in einem fundierten Video zusammen, „warum Gendersprache scheitern wird“. Als eine Antwort auf ihr Video trudelt ein wiederum aussagekräftiges Video von Marvin Neumann ein, der sich eingesteht, da womöglich geirrt zu haben.
Vorab: Wer hier schreibt
Wenn du hier das erste mal liest und erst wissen willst, mit wem du es hier zu tun hast: Ich bin Miriam, [zum Zeitpunkt des Artikels] 41, habe Kommunikationsdesign studiert und arbeite mittlerweile als Kreativdirektorin in einer Augsburger Werbeagentur. Ich bin unverheiratet, habe keine Kinder, und, um einem eventuellen CrazyCatLady-Image entgegenzuhalten: Ich habe noch nicht mal eine Katze. All das waren teils meine bewussten Entscheidungen, teils ist es einfach so gekommen. Ich bin damit ganz zufrieden.
Oft genug mache ich mir Gedanken darum, wie es sich heute als Frau so lebt. Dabei habe ich das Rollenverständnis von Mann und Frau ständig im Blick – vor allem das archetypische Grundgerüst dahinter, wie in diesem Artikel. Mir ist es wichtig, dass Menschen gut miteinander auskommen. Geschlecht spielt da erstmal eine untergeordnete Rolle. (Dafür aber eine umso schönere, wenn sie denn eine spielt ;))
Zu meinem Werteverständnis gehört natürlich auch, sich wertschätzend zu artikulieren. Aber was in der letzten Zeit mit Sternchen und Doppelpunkten veranstaltet wird, führt meiner Meinung nach nicht zum Ziel. Schriftsteller und Feminist Nele Pollatscheck bringt es schon länger auf den Punkt, dass gegenderte Sprache sogar sexistisch ist. Da kann ich mich nur anschließen. Mehr dazu hörst du in diesem Interview.
Ich möchte ergänzen: Mir geht in der gegenderten Sprache der Mensch verloren. Und deswegen habe ich mich für mich gegen die aktuell gängigen Formen entschieden.
„Hattet ihr früher (k)ein Problem damit?“–Nö!
Berufswegen habe ich unterschiedlichste Gender-Schreibweisen seit über zehn Jahren vor der Nase. In meiner Arbeit habe ich viele Kunden aus dem Bereich Soziales, die gendern wollen oder es schlichtweg müssen – Vorgabe vom Ministerium.
So war das nicht immer: Als ich 2001 zu studieren begann, hatte ich kein Problem damit, als „Student“ bezeichnet zu werden. Als immer mehr und mehr die „Studenten und Studentinnen“ seitens der Hochschule ausgerufen wurden, mussten ausgerechnet wir Studentinnen kichern: Was soll denn bitte diese geschwollene Sprache, die extra Hervorhebung? Nicht wenige – ich auch – fühlten sich unangenehm bevormundet bis benachteiligt: Wie peinlich, extra zu betonen, dass im Hörsaal auch Mädchen sitzen. Na klar tun wir das – wir machen es doch schon!
Folgende reale Begebenheit macht es noch absurder: Als Gendern an den Unis einzog, mussten die Profs am Anfang des Semester fragen, wie sie die Studierenden ansprechen sollen. „Als Stundentinnen!“, beschloss der Hörsaal lachend. Darin saßen nur lauter Männer. Mathe, Physik oder so – das ganze hat mir ein Typ auf unserem Date erzählt. Mal ehrlich: Wenn ich das als Frau höre, weiß ich nicht, ob ich auch lachen soll – oder einen Wutanfall bekommen. Theoretisch könnte ich mich als Frau erst recht verarscht fühlen, wäre es nicht so absurd.
Wir Design-Studentinnen hatten damals also offensichtlich kein Problem mit dem generischen Maskulinum, aber es wurde immer mehr und mehr eines draus gemacht, bis die Doppel-Nennung zum kleinsten Problem wurde: Wenige Jahre später sah ich mich im Berufsalltag mit typographischen Herausforderungen konfrontiert, die wir im Studium so nicht gelernt hatten – es gibt nunmal kein verbindliches Regelwerk für die gender-gerechte Schreibweise. Am allerwenigsten, wie richtig getrennt wird:

Da ich meinen Job nach wie vor als Dienstleistung sehe und mein Beruf ja von Haus aus erfordert, für jeden Fall eine kreative Lösung zu finden, habe ich kein Problem damit, solche Aufgaben im bestmöglichen Sinne für den Kunden zu lösen. Und auch wenn ich im privaten Rahmen kein Fan von Sternchen-Schreibweisen und Doppelnennungen bin, weise ich meine Kundinnen immer darauf hin, wenn mir auffällt, dass irgendwo eine ungegenderte Form durchgerutscht ist. Wir wollen ja alle unseren Job vernünftig machen.
Nur frage ich mich immer mehr und mehr, warum man es macht. Denn je länger ich solche Texte vor der Nase habe, umso mehr merke ich, wie wenig es funktioniert. Und ich frage mich auch, warum immer mehr Leute mitmachen – sogar die, die anfangs gekichert, mit den Augen gerollt oder sich teilweise sogar auch im übelsten Stil darüber lustig gemacht haben.
Alles eine Macht der Gewohnheit?
„Ach, Miriam. Die andren gendern mittlerweile, weil sie es kapiert haben – und du halt nicht!“ Gut, dann bin ich halt dumm. Im Gegensatz zu vielen, die erst jetzt gendern und wo der Verdacht nahe liegt, dass sie es relativ unreflektiert tun und/oder, weil sie meinen, sie müssten es, habe ich aber immerhin versucht, es in wirklich zu verstehen.
2019 bin ich in Richtung Feminismus abgetaucht. Dazu gehörte natürlich auch die politisch korrekte Sprache: Ich las die entsprechende Literatur und tauchte interessiert und voll motiviert in die Bubble ein: Julia Korbik und Margarete Stokowski lieferten mir nun meine Lieblingslektüre. Mit ein paar Augsburgerinnen traf ich mich monatlich gar bei einem feministischen Stammtisch. Nur kurze Zeit, und ich hatte in gegenderter Sprache zu denken begonnen! Sehr einprägsam der Moment, als ich kurz nach dem Aufwachen – oder war es doch vorm Einschlafen? jedenfalls zu einem Zeitpunkt, in dem das Hirn nicht ganz da ist – plötzlich hochschreckte: „Ich bin doch eine Menschin!!! Verdammt nochmal, warum gibt es das Wort nicht?“ Rummstataaa, es war soweit! Im Unterbewusstsein werkelte die Thematik fleißig weiter. Und das nach nur wenigen Tagen.
Was geht bitte in den Gehirnen ab, die sich wesentlich länger damit beschäftigen?
Die „Macht der Gewohnheit“ funktioniert ja in jede Richtung: Ist erst einmal etwas etabliert, hält das Gehirn panisch daran fest. Das spart nämlich ganz einfach Energie (dazu hier ein spannendes Interview mit Hirnforscher und Philosoph Gerhard Roth). Kein Wunder, dass nun immer weiter gegendert wird: Denn die, die es längst tun, meinen eben, es würde klappen.
Selbstkorrektur ist gerade in der Wissenschaft wichtig – und leider ziemlich selten. Wenn die eigene Reputation und die bisherige Arbeit auf dem Spiel steht, wer sagt da schon gerne: „Oh sorry, nö, nochmal zurück auf Anfang – alles falsch, ich habe mich geirrt!“
Gendern klappt einfach nicht – auch nicht, wenn man mit der Moralkeule darauf pocht
Diese Menschin hier hat sich also nach einiger Zeit eingestehen müssen, dass es mit dem Gendern nicht wirklich klappt. Niemals vollumfänglich: Wir werden das mit dem Gendern einfach trotz größten Bemühens mit den bisherigen Ideen nicht meister*innenlich hinbekommen. Spätestens bei solchen „konjugierten“ Formen, die es dann ja der Konsequenz halber bräuchte, stellen sich mir alle Haare auf. Also habe ich eine Klammer aus meinem Haar gezogen – irgendeine steckt da immer drin – und voller Überzeugung in die die rosa, pardon, regenbogenfarbene Feminismus-Gender-Bubble gepiekst.
Puh, das atmet sich gleich so viel freier! Denn wenn ich genauer hinsehe, ist oft ausgerechnet die regenbogenfarbene Bubble, die am lautesten nach Vielfalt und Buntheit schreit, genau dieselbe, die exakt das am allerwenigsten akzeptiert. Diversität ist nur so lange cool, wie sie ins eigene Weltbild passt. Was nicht passt, wird mit der Moral-Keule passend gemacht.
Was hat das mit Gleichheit und Gerechtigkeit zu tun?
Kann etwas gut und sinnvoll sein, das alles unnötig verkompliziert?
Auf Empfehlung eines Kollegen hin habe ich mir vor einiger Zeit ein Fachbuch gekauft: „Design ist mehr als schnell mal schön“ von Maren Martschenko. Der Titel hat mir sofort gefallen. Der Rückentext aber so gar nicht: „Als Designerin oder Designer stellen Sie die Kundinnen und Kunden ihres Auftraggebenden ins Zentrum ihres kreativen Schaffens.“ Pleeease, what? „Die werden schon nicht im ganzen Buch so akribisch durchgendern!“, dachte ich mir und kaufte das eingeschweißte Buch. Knibbelte daheim die Folie ab – und wurde eines Besseren belehrt. Ich habe es nur bis Seite 55 geschafft. Zu mühsam, da zu lesen, spätestens in der Satzmitte habe ich meistens schon wieder vergessen, wie der Satz angefangen hat. Worum ging es gleich wieder?
Maren schreibt im Nachwort: „Wir, ich und der Verlag, haben intensiv darüber diskutiert, wie Gleichstellung gelingen kann, ohne dass die Lesbarkeit leidet. Es bleibt an manchen Stellen holprig, weil unsere Sprache hier noch Gestaltungsbedarf hat. Ich traue Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, zu, dass Sie darüber hinweg lesen und sich nicht davon abhalten lassen, Ihren eigenen Weg in die gestaltende Beratung zu gehen. [Absatz] Ich danke meiner Twittercommunity, die mir beim Finden geschlechtergerechter Worte half, wo kein Leitfaden mir Antworten geben konnte.“
Obwohl ich nicht hochgradig ungebildet bin, kann ich nicht darüber hinweg lesen – ich schaffe es einfach nicht. Das mag mein individuelles Problem sein: Der Kollege, der mir das Buch empfohlen hat, ausgerechnet ein alter, weißer, Mann (!!!11!1!) hatte damit keine Probleme. Er meinte vorsichtig, dass es an meiner Einstellung läge. Womit er Recht hat: Mit sind Inhalt, Klarheit und Vermittlung als wesentliche Charakteristika der Sprache nunmal wichtiger als geschlechtergerechte Satzungetüme.
Wenn ich dieses Buch lese, hört es in mir nicht auf zu schreien: „Lass die Beidnennung weg und komm endlich zum Punkt! Ich will wissen, worum es geht!“ Dass Menschen jeden Geschlechts Designer, Kunden oder Auftraggeber sein können, weiß ich doch selbst. Ich hatte gehofft, mir würde hier verraten, wie die Zukunft für gestaltende Berater bzw. beratende Gestalter wird. Wie meine berufliche Zukunft nun bestenfalls aussehen soll: Keine Ahnung, da ich es nie weiter als bis zur Seite 55 geschafft habe.
Zudem: Die Doppel-Schreibweise, für die sich Maren und der Verlag entschieden haben, und für die Marens Twitter-Community als beratendes Gremium herhalten durfte, schließt das dritte Geschlecht konsequent aus. Hat ja super geklappt mit der Gleichstellung! Und das trotz Twitter? Kann doch nicht sein … Vielleicht habe ich aber auch nur irgendwo das Kleingedruckte übersehen:
„Im Sinne der besseren Unlesbarkeit haben wir uns für die feminine und maskuline Bezeichnung entschieden. Alle Menschen eines anderen oder gar keines Geschlechts dürfen sich aber auch angesprochen fühlen.“
text, der fehlt
Die Sache mit dem „angesprochen fühlen“
Als die Forderung nach geschlechter-gerechter Sprache immer lauter wurde, wurde folgender Passus im Kleingedruckten immer üblicher: „Im Sinne der besseren Lesbarkeit …blablabla … alle sind damit angesprochen.“ Das reiche aber nicht und sei immer noch ungerecht, monieren viele Feminist*innen. Ihnen ist das generische Maskulinum als Abbild patriarchalischer Strukturen ein Dorn im Auge. Man müsse sich schon die Mühe machen, wirklich alle Geschlechter zu nennen.
Sie vergessen darüber, wofür das generische Maskulinum tatschlich steht: Es ist vollkommen und absolut geschlechtsneutral. Das generische Maskulinum ist so neutral, dass selbst die Männer „nur mitgemeint“ sind.
Das generische Maskulinum ist nicht so „böse“, wie man*frau es lange dachte.
Nun kann man sagen: „Aber, aber, man muss doch und überhaupt und aaaaah, das generische Maskulinum, das geht–einfach–gaaaar–nicht! Da werden Frauen und andere nicht abgebildet! Und das muss man, weil …“ Dazu später mehr.
Zu dem in Misskredit geratenen generischen Maskulinum gibt es jedoch recht frische Studien, die zeigen, dass es Frauen bei Weitem nicht so stark ausschließt wie bislang angenommen. Studien aus den Niederlanden und Deutschland veranschaulichen mit Eye-Tracking-Methode, dass das lesende Auge NICHT zurückspringt, wenn zuerst das generische Maskulinum und danach eine feminine Nennung folgt:
„Die Wissenschaftler betraten den Konferenzraum, und Marie Schmid begann zu sprechen.“
Es entsteht im Hirn also keine Verwirrung, was es veranlassen würde, noch einmal zum Satzanfang zurück zu springen. Hätte man mich an eine Eye-Tracking-Maschine angeschlossen, als ich „Design ist mehr“ lesen wollte, wäre sie vermutlich explodiert.
Die Studie zeigt also: Es ist in der Regel unnötig, die feminine Form extra zu betonen.
Mehr Bedarf für die Beidnennung aller Geschlechter wird jedoch höchstvermutlich nötig, sobald man von „Astronauten auf der IS“ spricht: Bei Berufen, die bislang überwiegend männlich konnotiert sind, kann es durchaus hilfreich sein, auf die Frauen extra hinzuweisen. Aber kapiert nun ein Mädchen, das es auch Astronautin werden kann, weil es nur die Formulierung „Astronaut*in“ kennt – oder weil sie ein Video mit einer Astronautin sieht? Was wirkt da wohl mehr? Wäre es nicht das stärkste, wenn die eigene Mama Astronautin ist?
PS: Was ist mit d’ Nonbinären, d’ Hebamm werden möchten?
Es braucht mehr echte Erfahrungen und gelebte Realität als theoretische Kunst-Eingriffe in die Sprache. Auch eine Angela Merkel hat es bis zur Bundeskanzlerin geschafft, obwohl ihr damals keine gendergerechte Sprache den Weg geebnet hat.
„Sprache formt das Sein!“
Dass Sprache Wahrnehmung fördert, ist auch ein, wenn nicht sogar das Argument für gegenderte Sprache: Sie sei das maßgebliches Instrumentarium dafür, was real gelebt würde. Deswegen müssen wir Frauen – und alle anderen Geschlechter – in der Sprache abbilden, sichtbar machen. Zumindest, wenn es nach der feministischen Sprachforschung geht.
Nun gibt es im Gebiet der Sprachforschungen aber auch andere wissenschaftlich ebenso valide Stimmen, die in der Diskussion gerne mal unter den Tisch fallen. Weil sie nicht gefallen.
„Das Sein formt die Sprache. Umkehren lässt sich diese Kausalkette nicht. Andernfalls begint man sich in Gebiete der spekulativen Philosophie.“
fabian payr, germanistiker & romanistiker, autor des buches „von menschen und mesch*innen“
Sprachräume wie die Türkei und Ungarn bestätigen dies: In diesen Sprachen kennt die Sprache kein Geschlecht. Diese Länder müssten also ein wahrgewordene, gendergerechter Wunsch(t)raum sein. Der Alltag in diesen Ländern zeichnet leider ein komplett anderes Bild … (Vgl. den Podcast von Deutschlandfunk Kultur „LGBTQ in der Türkei – Der Kampf um Identität“).
Wieso mühen wir uns also im deutschen Sprachraum mit einer vermeintlich gendergerechten Schreibweise oder der Unsichtbarmachung jeglichen Geschlechts ab?
Weil wir im Deutschen zu viel Maskulines in der Sprache haben?
„Die Deutsche Sprache ist voller Männer!“
Das Deutsche ist voller „-er“! Nur steht das scheinbar männliche Suffix keinesfalls automatisch für das männliche Geschlecht: So haben wir in unserer Sprache auch ganz viele Gegenstände, die auf „-er“ enden – man denke nur an den Tennisschläger oder den Kopfhörer. Geschlecht? Gibt’s da logischerweise keins. Das grammatikalische Geschlecht hat keinen automatischen Bezug zum tatsächlichen Geschlecht. Das macht das Deutsche ja auch so schwer zum Lernen: Der Löffel, die Gabel, das Messer … häh?! Wenn es nach der „Männlichkeit“ dieser Dinge ginge, ihrem Aggressionspotenzial sozusagen, müsste es doch sein: Der Messer, das Gabel, die Löffel. Bevor Du Dir jetzt Dein Hirn komplett verknotest, atme tief durch auf folgendes Mantra:
Genus ≠ Sexus
Das grammatikalische Geschlecht hat nichts, nothing, nada mit dem tatsächlichen Geschlecht zu tun! Das haben wir doch alle irgendwann mal gelernt.
Logischerweise ebenso grammatikalisch ungeschlechtlich sind Nomina Agentis, also Begriffe, die zum Ausdruck bringen, dass hier jemand etwas macht.

Was dem Verb sein „-en“, ist dem Nomen Agentis halt sein „-er“. Unabhängig davon, welches Geschlecht derjenige hat, der es macht.m Warum das Suffix nun „-er“ lautet: Mein Gott, wer weiß das heute schon?
Ich könnte mir gut vorstellen, dass man aus der feministischen Ecke unkt, dass das eine Erfindung der Männer war. Aber Sprache hat keiner explizit erfunden, die hat sich entwickelt. Vielleicht sogar nur aus Versehen!
Das Suffix „-in“ wurde tatsächlich irgendwann explizit für die Frauenwelt eingeführt. Die Müllerin war dann aber nicht selbst Müller, sondern nur die Frau des Müllernden. Es ist also fraglich, ob diese sogenannten Movierungen die Frau tatsächlich stärken – oder vielmehr als Anhängsel von X schwächen.
Ja, die ganze Kiste ist verdammt kompliziert!
Wie wenig Gendern klappt, zeigt dieses wunderbar nüchterne, wissenschaftlich fundierte Video. Auch wenn da ein weißer, nicht ganz so alter Mann spricht und er noch dazu (uh-oh!?) auf dem Account der Welt spricht, schau Dir das ruhig mal an: Es gibt einen guten, umfassenden Blick auf das Thema, ohne in die eine oder andere Richtung drängen zu wollen. Trotzdem oder gerade deswegen sieht es am Schluss für gegenderte Sprache eher schlecht aus, und das generative Maskulinum steht als – wenn auch angeschlagener – Sieger da:
Auxkvisite These: „Das generische Maskulinum krankt an seinem Namen!“
„Generisches Maskulinum“ ist auch für mein Empfinden ein unglücklicher Name. Der wird zu seinem Image entsprechend beitragen. Dann nennen wir das Ding doch einfach anders! Das hat in der Unendlichen Geschichte oder mit dem Joggen ja auch geklappt. Machen wir das generische Maskulinum doch zeitgemäßer, damit auch absolut jede*r Depp*in versteht.
Ich schlage vor: „inklusives Substantivum“! Ich gehe damit noch einen Schritt weiter als Fabian Payr, der in seinem Buch „Von Menschen und Mensch*innen“ das „inklusive Maskulinum“ vorschlägt. Liebe Sprachwissenschaftler und Sprachwissenschaftlerinnen, was meint ihr? Wäre das ein passender neuer Name? Kämen damit am Schluss alle zurecht? Auch und vor allem die, die sich mit Sprache ohnehin eher schwer tun?
PS: Ist es nicht verrückt, dass das „generische Maskulinum“ als Begriff ausgerechnet von Feministinnen wiederholt zum Thema gemacht und deswegen erst so massiv betitelt und bekritelt wurde? Wenn Luise Pusch und ihre Kollegin Senta Trömel-Plötz in ihrem Themenband „Sprache, Geschlecht und Macht“ nicht so einen Trubel um dieses Thema gemacht hätten, würde es uns dann heute weit weniger jucken? Wenn man das Generische Maskulinum da einfach schon umbenannt hätte, würde es dann heute so massiv Thema sein?
Was beim Generischen Maskulinum so aufstößt, ist meiner Vermutung nach vielmehr sein bekloppter Name als das grammatikalische Konstrukt dahinter.
Wir brauchen eine Sprache, die für alle funktioniert
Von Seiten des intersektionalen Feminismus (=die sich um alle [potenziell] Diskriminierten kümmern) wird gefordert, dass man alle, alle, alle Menschen berücksichtigt. Soweit, so nobel.
Ausgerechnet diesem Anspruch arbeitet man aber massiv entgegen, wenn akribisch gendert. Diese Sprachform mit all den Sternchen und anderen tyographischen Behelfsmitteln funktioniert nicht oder nur schwer für Menschen …
- die Deutsch gerade neu lernen,
- mit Leseschwäche,
- die eine geistige Behinderung haben …
- … oder eine Sehschwäche (der Screen-Reader liest das Satzzeichen immer mit vor)
Ein Doppelpunkt ist zumindest im Screen-Reader schonmal die angenehmste Lösung, weil dann eben kurz pausiert wird. Ob es angenehmer ist, den Gender-Glottisschlag (die kurze Pause) zu hören, ist nochmal eine ganz andere Frage.
Was ist nun die Lösung?
Akribisch gegenderte Sprache symbolisiert in jedem Fall, dass man sich um Gender-Gerechtigkeit kümmert und das einem wichtig ist.
Aber was bringt das Ganze in echt, in der Realität, im Alltag, im Leben?
Für mich steht trotz meiner abnormalen Liebe zur Sprache das gelebte Leben eine Schippe über ihr. Und so sehr die Kraft der Sprache schätze – ich fürchte, an der Stelle überschätzen wir sie. Wenn mir jemand Beweise liefert, dass gegenderte Sprache tatsächlich Realität gestaltet hat, überlege ich es mir aber gerne nochmal!
Ich weiß nicht, was die perfekte Lösung ist. Für mich ist und bleibt es überwiegend das Generische Maskulinum / Inklusive Substantivum – aus den erwähnten Gründen.
Das harmoniert zudem mit meinem eigenen Werteverständnis am besten: Mir ist vor allem Klarheit wichtig, und– ja, dahinter stehe ich auch voll und ganz – die Eleganz und Schönheit und pure Ausdruckskraft, um nicht zu sagen die Lebendigkeit der Sprache. Gendern mit Satzzeichen an grammatikalisch falschen Stellen macht komische Krücken, die vorübergehend zu funktionieren scheinen, aber keine adäquate Dauerlösung sind. Nicht, wenn Sprache weiterhin können soll, wofür sie per definitionem da ist: Informationen flüssig vermitteln und Verbindung schaffen.
Politisch ausdrücken kann man sich via Sprache gerne, indem man die Inhalte ausdrückt. Aber nicht, indem man künstlich versucht, Sprache zu etwas Neuem umzuformen.
Ein lebendiger Umgang mit Sprache ist nötig
Um irgendwo hinzukommen, wo sich jeder wieder wohl fühlt, ist vor allem eines wichtig: Mit den anderen reden. Nicht nur mit der eigenen Bubble. Wir müssen aus der Komfortzone raus, die den Riss der gesellschaftlichen Spaltung so stark vorantreibt.
Vielleicht kommen wir durch eine offene, aufgeschlossene, sachlich-nüchterne Diskussion wieder dahin, wo wir vor gar nicht allzu langer Zeit bereits waren: dass Sprache funktioniert und praktikabel ist. Für alle. Ob sie auch jedem gefällt, ist eine subjektive Wahrnehmung und Entscheidung: Wer gendern will, der soll es tun! Aber er kann es nicht von anderen einfordern oder andere ad hoc verurteilen, wenn sie es nicht tun.
Wir müssen zurück zu mehr Achtsamkeit für alle!
Und zu mehr Achtsamkeit im Text: Wo macht es Sinn und ist es unabdingbar, das Geschlecht zu erwähnen? Wo ist es überflüssig?
Ja, das sind zusätzliche Überlegungen.
Ja, das ist anstrengend.
Aber so kann jeder für sich auch herausfinden, wie er mit Sprache umgehen will, wo es noch Bedarf gibt, hie und da etwas Sanftes, Verbindendes einfließen zu lassen, wo es das braucht. Ist das etwa automatisch weg, wenn ich hier kontinuierlich beim Mensch im Allgemeinen von „er“ schreibe? Wäre ein konsequentes „er oder sie“ so viel förderlicher? Im Sprachfluss sicher nicht.
Für mein Dafürhalten ist Sprache ein ungeeignetes Spielfeld für Politik: Nicht jeder, dem eine Sternchen-Form durchgerutscht ist – oder der sich willentlich dagegen entschieden hat –, ist ein misogyner Arsch. Vielmehr ist es doch interessant, sich die Menschen im echten Leben anzusehen: Gendert jemand nie, ist „aber ansonsten“ ein lieber Mensch? Dann kann er ja wohl kein misogyner Arsch sein.
Im Gegenzug sehe ich immer mehr Männer, die zwar fleißig und vorbildlich Gender-Sprache benutzen, sich weiterhin aber chauvinistisch verhalten: Dann steht ein perfekt gegenderter Text in der Image-Broschüre neben einem Bild mit einem sexy-lasziven Stock-Model. Das sind die Chefs, die permanent von „Mitarbeitenden“ sprechen anstatt von Mitarbeitern, aber dann ihrer Angestellten drei Sekunden zu lange in den Ausschnitt starren.
Sprache im Wandel
Ich hätte zu gerne zugesehen, wie sich die deutsche Sprache natürlich wandelt! Zu hören ist es ja schon im öffentlichen Leben, vor allem in den Öffentlichen: „Gehma Kino?“
Daran sieht man, wohin die Reise natürlicherweise gehen würde: Zur Vereinfachung. Ein bisschen wie im Film Cloud Atlas, wo es Halle Berry und Tom Hanks als Menschen der Zukunft vormachen: Eine Mischung aus Denglisch und Babysprache, ein bisschen Yoda schwingt auch mit.
Viel zu lernen wir noch haben!
Aber lasst uns deswegen nicht absichtlich verlernen und zerstören, was wir gelernt haben und das sich darüber hinaus jahrhundertelang bewiesen hat, dass es funktioniert. Etwas Neues darf das Alte erst dann ablösen, wenn es besser ist. Und nicht, weil es neu, politisch korrekt und/oder schick ist!
Sprache ist zu wichtig und zu wertvoll als verbindendes Element. Wir brauchen sie in ihrer vollen Kraft und Funktionsfähigkeit, um sie für alle nutzen zu können.
Am Ende geht es doch um den Menschen
Wenn wir von Menschen reden, geht es doch um den Menschen an sich – und nicht, welches Geschlecht er hat. Wollten wir uns nicht von diesen Rollenbildern lösen?
Zumindest ich habe kein Problem, in einer Runde mit anderen Designern als „Designer“ angesprochen zu werden. In diesem Kontext geht es darum, dass wir Design machen. Und nicht, was sich zwischen meinen Beinen befindet.
Nun gibt es natürlich noch als Alternative zu den Sternchenformen und Beidnennungen die mehr oder wenige elegante Umschiffung der personen-bezogenen Form. Jetzt kümmert sich nicht mehr „ein Sachbearbeiter“ oder auch „ein*e Sachbearbeiter*in“ um meinen Fall, sondern „jemand aus der Sachbearbeitung“. Kann man schon machen, klingt aber leider nach einem furchtbar nüchternen Beamten-Sprech.
Die neutralen Formen lassen den Mensch komplett aus der Sprache verschwinden!
Ich will das nicht. Und noch weniger, dass man es auf Teufel*in komm raus überall versucht – nur aus einer Haltung der Angst heraus. Angst kann nie eine Lösung sein, hat schon Mutti gesagt!
„Wie spreche ich nun am besten?“
Wenn du die innere Haltung und die Intention hast, ein guter Mensch zu sein – oder meinetwegen auch eine gute Menschin oder Menschendes –, dann drückt sich das zwangsläufig auch durch Deine Sprache aus.
Egal, welche Form Du dafür verwendest.
Für welche entscheidest Du Dich?
PS:
Auf inhaltliche Fehler darfst du mich gerne hinweisen, zumal ich eben keine Sprachwissenschaftlerin bin und mir im Klaren bin, dass ich mich mit diesem Artikel weit aus dem Fenster lehne. Da ich in letzter Zeit mit immer mehr Bauchschmerzen dabei zusehe, wie sich Menschen in ihrem Ausdruck winden, um ja niemandem potenziell auf die Füße zu treten, und wie jeder Mann automatisch als „alter weißer Mann“ beschimpft wird, der sich da kritisch äußert, kann ich nicht länger meinen Mund halten und möchte der Diskussion eine weitere, eben meine Ansicht anbieten: Als Frau, irgendwie feministisch und irgendwie auch nicht, die mit Sprache in ihrem Berufsalltag als Kommunikationsdesignerin und Texterin seit über zehn Jahren zu tun hat.
Als Grundlage habe ich mich neben meinem eigenen Erleben und Empfinden auf das Buch „Von Menschen und Mensch*innen“ von Fabian Payr gestützt (Unbezahlter Link zu buecher.de). In diesem Buch gibt es massenhaft Quellen zu Studien und Fachartikeln. Einen Link zu einer ebenso umfangreichen Quellenangabe findest du in dem oben verlinkten YouTube-Video von Constantin van Lijnden.
Meine Expertise im Design mag einen Einfluss auf mein ästhetisches Sprachempfinden haben. Das erscheint mir aber ebenfalls individuell: Ich kenne und habe genügend Kollegen, die das anders sehen und gerne gendern.
PPS:
Auf dem Instagram-Post zu diesem Artikel ging es einigermaßen ab. Hier gab es neben „Sehe ich als Frau genauso!“ auch ganz viel Gegenwind: Für Feminist*innen ist meine Meinung natürlich harter Tobak. Lukas Thüring hat sogar darauf mit einem eigenen Artikel reagiert. Ihn nervt die Diskussion eben so wie mich, aber eben aus der anderen Perspektive. Er beleuchtet die Sprachhistorie aus einem fundierteren Hintergrund. Im Gegenzug dazu sind ihm inhaltliche Schnitzer bei dem Thema Typographie und Gestaltung unterlaufen (Lesbarkeit und Leserlichkeit sind zwei paar Schuhe; die beste Typographie reißt keinen schlechten Text heraus – schriftliches Gendern gut lesbar zu machen liegt also keinesfalls nur in den Händen der Gestalter). Was nur mal wieder zeigt, dass bei jedem noch so motiviertem Engagement Fehler passieren. Aber zeichnet eben nicht gerade das auch das Menschsein aus? Lieber Leidenschaft und sich kleine Schnitzer leisten anstatt mit einem Schulterzucken alles hinnehmen und somit vermeintlich alles richtig machen.
Obwohl mit dieser Unmut, den mein Artikel erregen kann, zugegeben nicht besonders behagt, zumal mir ein freundliches Miteinander nach wie vor am liebsten ist, lasse ich ihn dennoch weiter stehen. Ich nehme auch weiterhin den Affront entgegen, wenn ich dafür den Raum öffnen kann, dass ein bewusstes „Nicht-Gendern“ nichts mit Menschenunfreundlichkeit oder antiquierter, bornierter Sichtweise zu tun hat. Seht es mir aber bitte nach, wenn ich nicht die Zeit habe, auf alles (schnell) zu antworten.
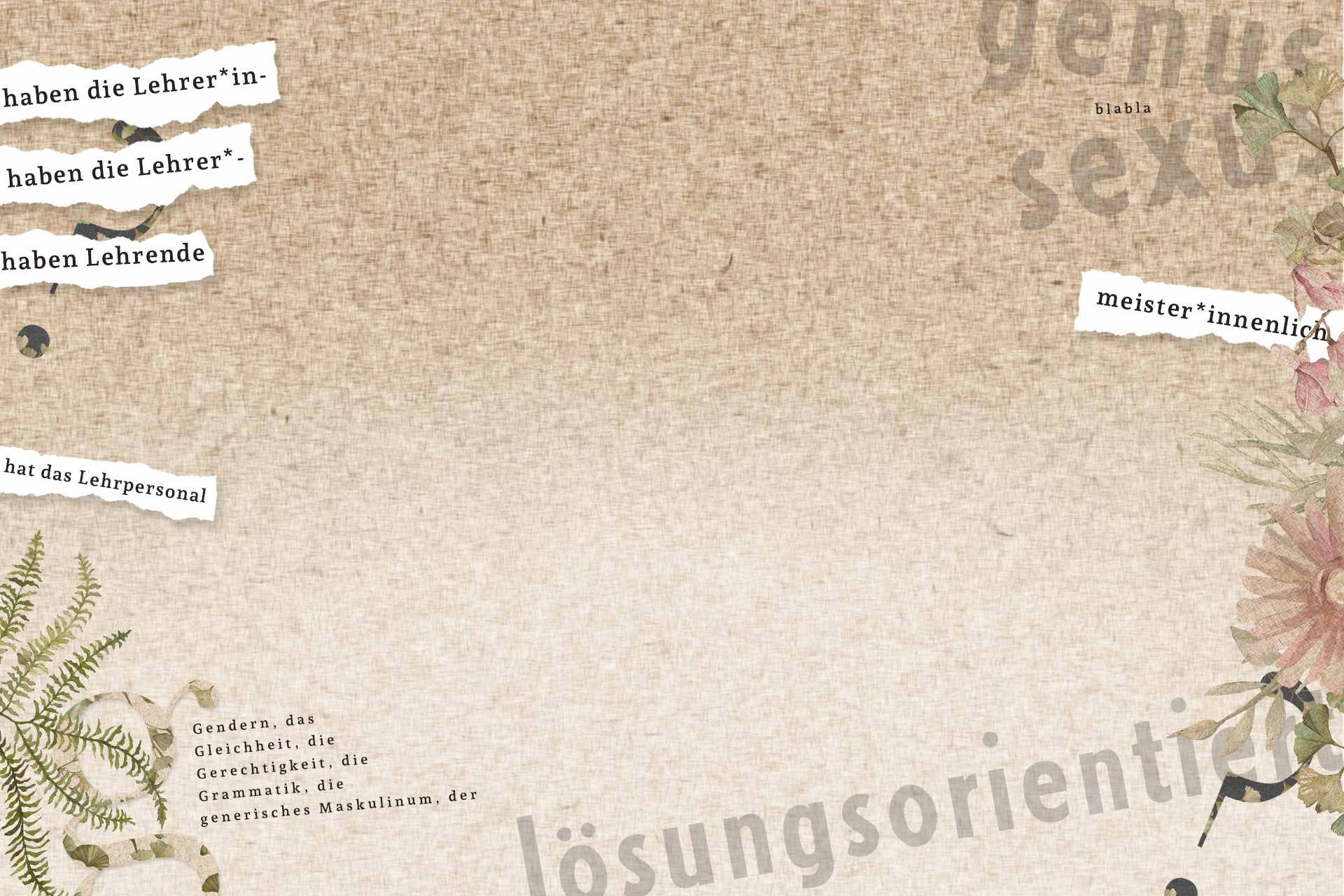







2 Kommentare
Wieviele Einwohner hat Deutschland?
83 Millionen? Falsch:nach der neuen Sprachinquisitioin sind es 41,5 Millionen Einwohner und 41,5 Millionen Einwohnerinnen.
Huch, Wolfram, tut mir leid: Deinen Kommentar sehe ich erst jetzt!
Ich verstehe ihn zugegeben nicht ganz – wenn du da nochmal nachfassen willst …